.
Archiv für die Kategorie ‘Kultur’
Nawalny: Ich bin ein sehr glücklicher Mann Leave a comment
Ich bin ein sehr glücklicher Mann. Du weißt es wie ein Hund, der einen Regenbogen gesehen hat. Mich hat etwas berührt, das so real, aufrichtiges, aufrichtiges, leichtes existiert, das die meisten Menschen einfach nicht glauben können. Na wie erklärt man einem Blinden was der Himmel ist?
Gottes letztes Schlupfloch Leave a comment
.
Die Quantenphysik basiert auf Zufall, da sind sich Physiker eigentlich sicher. Aber ein Restzweifel bleibt. Ein neues Experiment soll ihn aus der Welt schaffen.
.
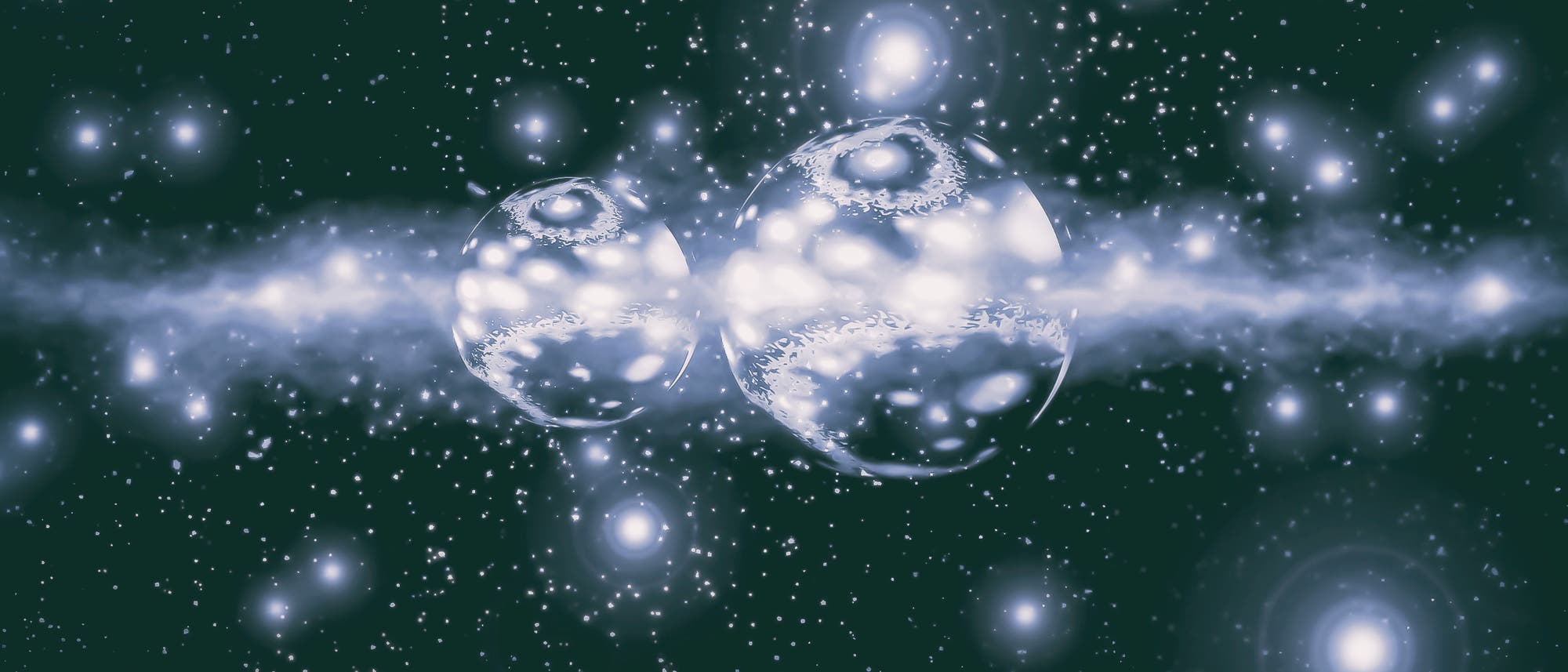
.
.
Was lenkt das Universum? Seit Anfang des 20. Jahrhunderts glauben Physiker die Antwort zu kennen: Die Welt basiert auf Zufall. Er bestimmt, ob Atomkerne von einem Moment auf den nächsten zerfallen. Ob Elektronen nach links oder rechts hüpfen. Oder ob aus dem Nichts plötzlich ein Strahlungsblitz auftaucht, der den Mikrokosmos an einem entscheidenden Punkt in eine ungeahnte Richtung lenkt.
Das besagen zumindest die Formeln der Quantenphysik, die Physiker wie Niels Bohr, Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger vor einem knappen Jahrhundert entwickelten. Aber ist das die ganze Wahrheit? Gibt es wirklich niemanden, der vor jeder Quantenbewegung entscheidet, welchen Weg die Natur wählt? Albert Einstein hatte mit dieser Vorstellung große Probleme. »Gott würfelt nicht!«, soll er sinngemäß gesagt haben.
Gott würfelt eben doch
Momentan sieht es so aus, als ob das Jahrhundertgenie irrte – Gott würfelt doch, und zwar immer. Längst haben Experimente nicht nur den Zufallscharakter der Quantenphysik bewiesen, sondern auch andere Besonderheiten zu Tage gefördert. So befinden sich Quantenobjekte stets in einer Überlagerung mehrerer Zustände, ähnlich wie ein Fußball, der gleichzeitig vor und hinter der Torlinie liegt. Erst bei einer Messung entscheidet die Natur auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, wo genau sich ein Objekt befindet (oder welche Eigenschaften es hat).
Besonders bizarr wird es, wenn Physiker mehrere interagierende Teilchen beschreiben, beispielsweise Photonen, die Quantenteilchen des Lichts. Ihre Zustände sind dann ebenfalls überlagert, und kurioserweise bleibt das so, wenn sich die Lichtteilchen voneinander entfernen. Die Folge ist kaum vorstellbar: Bei einer Messung des einen Quants wird auch der Zustand seines Partners festgelegt, Physiker sprechen von »Verschränkung«.
Hoffnung auf verborgene Variablen
Besonders verrückt: Verschränkte Teilchen reagieren selbst dann noch auf die Messung ihres Partners, wenn dieses eigentlich zu weit weg ist, um das Signal mit Lichtgeschwindigkeit (der kosmischen Höchstgeschwindigkeit) zu übermitteln. Aus Sicht der meisten Menschen geht im Mikrokosmos also etwas höchst Seltsames vor sich.
Albert Einstein – er war wirklich kein Fan der Quantentheorie – verspottete diese Vorhersage seiner Kollegen als »spukhafte Fernwirkung«. Er vermutete, dass es eine tiefere, deterministische Ebene der Realität gibt, in der festgelegt wird, wie eine Messung ausgeht. Das würde den Zufall aus dem Weltbild der Physik entfernen.
Gemeinsam mit Boris Podolsky und Nathan Rosen ersann Einstein 1935 ein berühmtes Gedankenexperiment zu dieser Frage. Der Ire John Stewart Bell entwickelte den Gedanken weiter und entwarf 1964 ein Experiment, mit dem sich die Quantenphysik im Labor auf den Prüfstand stellen lassen sollte.
Bells Gedanke: Wenn die Quantenphysik wirklich rein zufällig ist, müsste das Maß, in dem die Zustände verschränkter Teilchen korrelieren, stets eine bestimmte Schwelle überschreiten. Mittlerweile wurden etliche dieser Bell-Tests durchgeführt. Das Ergebnis war stets eindeutig. Die Quantentheorie ist tatsächlich so, wie Einstein befürchtete: zufällig und ein glasklarer Verstoß gegen den »lokalen Realismus«, also die Annahme, dass Objekte kausal verknüpft sein müssen, wenn sie Einfluss aufeinander ausüben.
Doch kein Zufall?
Aber bis heute bleiben Lücken. Eines davon, das so genannte »Freedom-of-choice«-Schlupfloch, ist besonders schwer zu stopfen, und es zieht seit einigen Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich. Im Kern dreht es sich um die Frage, ob etwas den Physikern den Zufallscharakter in Quantenmessungen nur vorgaukeln könnte. Das ist bisher durchaus denkbar.
Physiker nutzen für ihre Bell-Tests lediglich Quantenobjekte, die von der Erde stammen. Beispielsweise verschränken sie zwei Photonen miteinander und testen deren Polarisationen mit Hilfe zweier optischer Modulatoren, die nur Lichtteilchen einer bestimmten Schwingungsrichtung durchlassen. Welche das ist, legen Zufallsgeneratoren fest. Über viele Messungen entsteht so ein Bild, wie stark die Zustände verschränkter Teilchenpaare korrelieren, beziehungsweise wie deutlich sie den lokalen Realismus verletzten.
[…]
Der Zufallsgenerator von Kaiser und Kollegen nutzt nicht bloß das Licht von Sternen aus der Milchstraße, sondern auch das von zwölf Quasaren. Dahinter verbergen sich die Kerne aktiver Galaxien, die immer wieder große Strahlungsmengen ins All feuern – und die Milliarden Lichtjahre voneinander und von uns entfernt sind.
Einige der extrem weit gereisten Photonen könnten künftig die Zufallsgeneratoren in Bell-Tests bestücken, schreiben die Forscher. Bestätigen solche aufgebohrten Tests erneut die Quantenphysik, müssten Kritiker argumentieren, dass sich Teilchen über eine Entfernung von Milliarden Lichtjahren abgesprochen haben. Damit würde der Raum für eine kosmische Quanten-Verschwörung deutlich schrumpfen.
Das ultimative Schlupfloch
Gut möglich, dass eine solche Messung findigen Experimentatoren in absehbarer Zeit gelingt. Aber mindestens ein Schlupfloch bliebe davon unberührt: Was, wenn schon beim Urknall etwas alle Teilchen im Universum weitsichtig manipulierte? Und zwar so, dass es bei heutigen Messungen so wirkt, als verhielten sie sich zufällig? Albert Einstein würde ein solcher »Hyper-Determinismus« womöglich gefallen. Bliebe nur die Frage, warum ein mutmaßlicher Schöpfer zu solch einer Heimtücke greifen sollte, um die Menschheit an der Nase herumzuführen.
Von Robert Gast
Gottes letztes Schlupfloch
Netrebko verklagt die New Yorker Metropolitan Opera Leave a comment
.
Ich hoffe diese Putin-Freundin Netrebko bekommt keinen einzigen Dollar. Ich glaube auch nicht, dass sie mit ihrer Klage Erfolg haben wird.
Von suedtirolnews.it
.

APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
.
Nach der Einstellung der Zusammenarbeit als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat die Opernsängern Anna Netrebko (51) die New Yorker Metropolitan Opera verklagt. Die russisch-österreichische Doppelstaatsbürgerin reichte übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge am Freitag (Ortszeit) in New York eine Klage ein, in der sie Schadenersatz in Höhe von mindestens 360.000 US-Dollar (328.887,27 Euro) verlangt.
Das Opernhaus wies die Anschuldigungen zurück, die Klage habe “keinen Wert”, hieß es in einer Mitteilung. Schon zuvor hatte sich Netrebko über die US-Gewerkschaft der Operndarsteller teilweise erfolgreich um Ausfallzahlungen von der Metropolitan Oper bemüht.
Das berühmte Opernhaus in Manhattan hatte im März 2022 kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine angekündigt, die Zusammenarbeit mit Netrebko auf Eis zu legen. Das Opernhaus habe Netrebko aufgefordert, ihre öffentliche Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückzuziehen. Dies habe die Russin aber nicht getan, hatte die Oper mitgeteilt. Daraufhin hätte Netrebko sich von geplanten anstehenden Auftritten zurückgezogen. Direktor Peter Gelb sprach von einem “künstlerischen Verlust”, sah aber eigenen Angaben zufolge “keinen anderen Weg”.
In Österreich tritt sie weiterhin auf und wird von Kunstkritikern etwa für ihre Darbietungen an der Wiener Staatsoper gefeiert, doch ansonsten gilt Netrebko nicht nur als Unterstützerin Putins, sondern auch der pro-russischen Separatisten in der Ostukraine. Ende 2014 trat sie mit dem Separatistenführer Oleg Zarjow auf und ließ sich dabei auch mit der Fahne des sogenannten “Neurussland” fotografieren. Vom russischen Angriff auf die Ukraine distanzierte sie sich erst mit Verzögerung und nach Ansicht von Kritikern nicht aus Überzeugung, sondern vor allem aus Sorge um ihre weiteren Engagements. Für die Ukraine ist sie weiterhin eine Kreml-Propagandistin, weswegen sie vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch mit scharfen Sanktionen wie einem Einreiseverbot und Vermögenssperren belegt worden ist
Von: APA/dpa
Mal ein wenig Satire … Leave a comment
Putins Propagandakünstler Leave a comment
.
Im Dienste des Bösen
Auszug.
Autor: Stephan Burianek
Wer Anna Netrebko kritisiert, der muss erst recht den nicht minder gefeierten Bass Ildar Abdrazakov unter die Lupe nehmen. Für die Direktoren der führenden Opernhäuser in Europa ist es an der Zeit, endlich zu handeln.
Wie die große, 2019 betagt verstorbene österreichische Kammersängerin Hilde Zadek wohl die aktuelle Situation einschätzen würde: Ein Sänger müsse ein globales Wissen haben, das weit über das eigentliche Fach hinausgehe und neben einem allgemeinen Verständnis für Kunst und einer Menschenkenntnis auch die Politik inkludiere, sagte sie in einem Ö1-Interview im Jahr 2011, das kürzlich erneut ausgestrahlt wurde. Ein Sänger müsse durch ein intensives Studium der Menschheitsthemen „zu einem wirklichen Menschen“ werden und nicht „bloß zu einem Sänger“, sonst sei er einer Verkörperung der jeweiligen Partie nicht gewachsen.
Putins Propagandakünstler
Hier noch extra der Link ausgeschrieben (weil jemand angab, ich hätte keinen Link angegeben, man muss aber nur auf „Putins Propagandakünstler“ oben draufklicken um auf der Seite zu landen).
https://opern.news/news/beitrag/419
Die klügsten Zitate von Arthur Schopenhauer, die du besser so früh wie möglich kennen solltest (Teil 1) Leave a comment
.
Rebloggt von Tierfreund Wolfgang – wolodja51.wordpress.com
Die Gesundheit überwiegt alle anderen Segnungen des Lebens so weit, dass ein wirklich gesunder Bettler glücklicher ist als ein kranker König.
Wer einmal das Vertrauen missbraucht hat, verliert es für immer.
Reichtum ist wie Meerwasser, je mehr wir trinken, desto durstiger werden wir, und dasselbe gilt für den Ruhm.
Meistens belehrt uns erst der Verlust über den Wert der Dinge.
Wir büßen drei Viertel von uns selbst ein, um wie andere Menschen zu sein.
Aus der Sicht der Jugend ist das Leben eine endlose Zukunft, aus der Sicht des Alters ist es eine sehr kurze Vergangenheit.
Lesen ist Denken mit dem Kopf eines anderen statt mit dem eigenen.
Die ersten vierzig Jahre unseres Lebens liefern den Text, die folgenden dreißig den Kommentar dazu, der uns den wahren Sinn und Zusammenhang des Textes nebst der Moral und aller Feinheiten desselben erst recht verstehen lehrt.
Gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie sie ihre Zeit verbringen. Ein intelligenter Mensch versucht, sie zu nutzen.
Man kann jedem Menschen zuhören, aber nicht jeder ist es wert, dass man mit ihm spricht.
Das Leben ist ein ständiger Prozess des Sterbens.
Jeder Mensch hält die Grenzen seines eigenen Gesichtsfeldes für die Grenzen der Welt.
Heiraten bedeutet, seine Rechte zu halbieren und seine Pflichten zu verdoppeln.
Es ist besser seinen Verstand in der Stille zu finden als im Gespräch.
Wer die Einsamkeit nicht mag, mag die Freiheit nicht, denn nur allein kann man frei sein.
.
Die klügsten Zitate von Arthur Schopenhauer, die du besser so früh wie möglich kennen solltest (Teil 1)
Martin und seine Katze Mogli reisen um die Welt Leave a comment
.
Von deutschlandfunknova.de
Seit vier Jahren reist Martin mit dem Motorrad um die Welt. Auf einer dieser Reisen traf er auf seine jetzige Reisebegleitung: die Katze Mogli. Sie hat nicht nur die Art des Reisens für Martin verändert, sondern gibt ihm auch ein Gefühl von Zuhause – ganz gleich, wo die beiden gerade sind.
Für Martin Klauka, der aus einem kleinen Dorf in Brandenburg stammt, war schon als Kind klar: ein normaler Alltag in Deutschland – das ist nichts für ihn. Dennoch hat es einige Jahre gedauert, bis er schließlich mit 31 Jahren alle Zelte abbaute, um mit seinem Motorrad die Welt zu erkunden. Im März 2017 fand er dann während seiner Reise durch Marokko eine kleine, zwei Monate alte Katze auf der Straße – der Anfang eines ganz neuen Reisekapitels von Martin und Mogli.
„Wo Mogli ist, fühle ich mich zuhause. Damit kommt dann auch keine Einsamkeit auf.“
Martin Klauka, reist mit Motorrad und Katze um die Welt
Und dann kam Mogli…
Schwach, dreckig und verletzt hat Martin die kleine Katze auf den Straßen von Marokko in Erinnerung. Als er sie traf, kam sie gleich in seinen Arm und blieb den ganzen Abend dort, erinnert er sich. Als er die Katze für eine Nacht bei sich behielt und ein paar Motorradprobefahrten mit ihr unternahm, war klar: Wenn es im August wieder auf die nächste große Tour geht, wird Mogli dabei sein.
„Ich habe sie dann auf das Motorrad gesetzt und wir sind eine Runde gefahren. Das hat dann relativ gut geklappt.“
Martin Klauka, reist mit Motorrad und Katze um die Welt
Allein in den ersten beiden Jahren hat er mit der jungen Katze 16 Länder bereist und mehr als 30.000 Kilometer zurückgelegt – von Dubai über Südosteuropa in die Türkei und weiter durch den Iran bis in die Vereinigten Arabischen Emirate.
So viel Fahrtkomfort für eine Katze wie möglich
Auf den Reisen war Martin wichig, Mogli immer an einer Leine zu haben, damit sie nicht durch plötzliche Geräusche davon läuft oder auf die Straße rennt. Da sie durch viele, sehr heiße Länder reisen, hat Martin irgendwann beschlossen, in den ehemaligen Kamerarucksack, in dem Mogli mitfährt, eine kleine Klimaanlage einzubauen.
.

Mogli in einer klimatisierten Reisetasche
.
Ab und zu, wenn Mogli Lust hat, setzt sie sich auch auf Martins Schulter beim Fahren. Ob Mogli ihr außergewöhnliches Katzenleben gefällt, kann Martin nur schwer sagen. Aber sie kenne es nicht anders und arrangiere sich schnell mit den neuen Orten, sagt er.
Wie eine Katze das Reisen verändert
Wenn Martin und Mogli sich an einem neuen Ort niederlassen, checkt Martin immer, dass es genug Rückzugsorte für Mogli gibt und keine Feinde wie Hunde, große Eulen oder auch Leoparden in der Nähe sind. Die eingeschränkte Ortswahl ist nicht das Einzige, das Martin in Kauf nimmt, um mit Mogli reisen zu können.
Schon simple Dinge wie Sand für das Katzenklo oder Katzenfutter seien nicht überall erhältlich. Manchmal fühle es sich an, wie mit einem Kind zu reisen, sagt er. Aber er habe sich das selbst ausgesucht und deshalb sei es ganz selbstverständlich, so zu reisen.
„Es ist fast, wie mit einem Kind zu reisen. Man ist schon ein bisschen gebunden.“
Martin Klauka über das Reisen mit einer Katze
Und auch seine Fahrweise habe sich durch Mogli verändert. Oft fährt er mit 30 km/h Slalom um Schlaglöcher herum, damit es keine Erschütterungen gibt und entscheidet sich gegen Off-Road-Routen, obwohl diese zum Fahren reizvoller wären. Bei starker Hitze bricht er in den frühen Morgenstunden auf, weil sonst auch die kleine Klimaanlage Moglis Fahrplatz nicht genug kühlen könne.
Auf seinem Instagram-Account hält Martin seine Reisen mit Mogli fest. Außerdem hat er seine Reisen in dem Buch „Einmal mit der Katze um die halbe Welt“ niedergeschrieben.
Deutschland ist weiterhin erstmal keine Option
Gerade lebt Martin mit Mogli in Uttarakhand in Indien in der Nähe des Himalaya Gebirges. Auf knapp 2000 Meter wohnt er in einem kleinen Dorf mit 1000 Menschen mitten in den Hügeln. Hier hatte er sich vor drei Jahren schon mal niedergelassen und sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder für diesen idyllischen Ort entschieden. Nach Deutschland zurückzukehren, kann sich Martin derzeit nicht vorstellen.
.
Martin und seine Katze Mogli reisen um die Welt
.
Mit Motorrad und Katze rund um die Welt – Video BR Mediathek.
https://www.br.de/mediathek/video/motomogli-mit-motorrad-und-katze-rund-um-die-welt-av:637b4f0da4279000084bbe0b
Bodo Wartke – Nicht in meinem Namen Leave a comment
Sterbehilfe – Die Story im Ersten Leave a comment
.
Mein Körper gehört auch beim Sterben mir. Bei dieser Selbstbestimmung hat kein Staat oder eine andere Institution dreinzureden. Dazu hat man auch das Recht, wenn man nicht unheilbar krank ist oder starke Schmerzen hat, entschied das Bundesverfassungsgericht.
Die Neuregelung der Sterbehilfe in der 20. Wahlperiode
Über zwei Jahre ist es nun schon her, dass das Bundesverfassungsgericht § 217 StGB für verfassungswidrig erklärt hat. Der Senat stellte in seiner wegweisenden Entscheidung fest, dass jeder Mensch ein grundrechtlich verbürgtes Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Dieses umfasst auch die Hilfe anderer.
Die Beantwortung der Frage, wie das Recht auf selbstbestimmtes Sterben zukünftig legislativ eingebettet werden soll, ist jedoch Aufgabe des Gesetzgebers. Bereits in der vergangenen Wahlperiode haben wir als eine interfraktionelle Gruppe aus Abgeordneten, bestehend aus mir, Katrin Helling-Plahr (FDP), sowie Dr. Petra Sitte (Linke), Dr. Karl Lauterbach (SPD), Swen Schulz (SPD) und Otto Fricke (FDP), einen Vorstoß gewagt und einen liberalen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der eine Regelung der Suizidhilfe außerhalb des Strafrechts vorsieht. Nach einer personellen Neuaufstellung unserer Gruppe – nun unter Mitwirkung von Helge Lindh (SPD) und Till Steffen (Bündnis 90/Die Grünen) – gilt es nun in der 20. Wahlperiode keine Zeit mehr zu verlieren.
Damit die Debatte wieder fahrt aufnimmt, haben wir im März 2022 eine Podiumsdiskussion über die Neuregelung der Sterbehilfe veranstaltet, an der neben Abgeordneten der Gruppe zahlreiche Expertinnen und Experten teilgenommen haben. Am 18. Mai 2022 folgte sodann die Orientierungsdebatte im Bundestag, bei der wir noch einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter für unseren Gesetzentwurf gewinnen konnten. In Kalenderwoche 25 steht nun die erste Lesung unseres Gesetzentwurfes im Plenum an.
Im Mittelpunkt dieses Entwurfes steht der Einzelne, der mit seinem Sterbewunsch nicht länger allein gelassen werden soll. Wir wollen allen Beteiligten einerseits Rechtssicherheit bieten sowie andererseits ein niedrigschwelliges Beratungsangebot zur Seite stellen.
Welche Erwägungen uns noch bei der Erstellung unseres Gesetzentwurfes geleitet haben, können Sie in unserem FAQ nachlesen.
Unseren Gesetzentwurf finden Sie hier.
https://www.helling-plahr.de/podiumsdiskussion_sterbehilfe
.
.
„Die Story im Ersten: Sterbehilfe“ – Harald Mayer kämpft um seinen Tod
Stand: 21.11.2022
Tina Soliman hat den unheilbar kranken Harald Mayer vier Jahre lang mit der Kamera bei seinem Kampf um einen selbstbestimmten Tod begleitet. Der eindringliche Film läuft heute ab 22.20 Uhr im Ersten und ist schon jetzt in der ARD Mediathek abrufbar.
Für jeden Handgriff braucht er einen Pfleger: nachts, wenn er sich umdrehen will, zum Naseputzen, Zudecken, Tränentrocknen. Harald Mayer lebt in totaler Abhängigkeit. Multiple Sklerose hat ihn bewegungsunfähig gemacht. Der ehemalige Feuerwehrmann hat Angst, dass er bald weder schlucken noch atmen kann. Und trotzdem weiterleben muss. Bei vollem Bewusstsein. „Das Leben, das ich habe, das ist kein Leben mehr!“ Harald Mayer will Sterbehilfe.
Assistierter Suizid gesetzlich erlaubt
Die hat er nie bekommen. Denn 2015 hatte der Bundestag die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten. Doch das Bundesverfassungsgericht erklärte dieses Gesetz später für grundrechtswidrig, der assistierte Suizid ist seit dem Urteil ohne jede Einschränkung erlaubt. Der Bundestag muss die Sterbehilfe nun neu regeln, wenn er sie einschränken will. Darauf hofft Harald Mayer. Der Schwerstkranke kämpft seit Jahren vor Gericht um die Herausgabe eines Medikaments, dass ihn sanft im Kreis seiner Familie entschlafen ließe. Einer Sterbehilfe-Organisation möchte er sich nicht anvertrauen.
„Die Story im Ersten: Sterbehilfe“ zeigt unterschiedliche Perspektiven
Die vielfach preisgekrönte Autorin Tina Soliman hat den unheilbar kranken Harald Mayer vier Jahre lang mit der Kamera bei seinem Kampf um einen selbstbestimmten Tod begleitet. Entstanden ist ein eindringlicher, oft sehr berührender Film, der die Sterbehilfe aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
https://www.ndr.de/kultur/film/tipps/Die-Story-im-Ersten-Sterbehilfe-Harald-Mayer-kaempft-um-seinen-Tod,sterbehilfe400.html
.
.
Sterbehilfe: Harald Mayer kämpft um seinen Tod
21.11.2022 ∙ Dokus im Ersten ∙ Das Erste
Harald Mayer will Sterbehilfe: Für jeden Handgriff braucht er einen Pfleger, nachts, wenn er sich umdrehen will, zum Naseputzen, Tränentrocknen. Harald Mayer lebt in totaler Abhängigkeit. Multiple Sklerose hat ihn bewegungsunfähig gemacht.
https://www.ardmediathek.de/video/dokus-im-ersten/sterbehilfe-harald-mayer-kaempft-um-seinen-tod/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuLzliMmFkZGZiLTAxN2YtNGEwYS1iNTkwLWYxOWQwZjk4NWYyZg
In Memory of Karlheinz Deschner (Teil 14) Leave a comment
.
Rebloggt von Tierfreund und Religionskritiker Wolfgang. wolodja51.wordpress.com
Aphorismen und Zitate (2)
-
Nichts erschüttert weniger die Welt als ein lebenslang gebückter Rücken – und nichts erhält sie mehr.
-
Warum dringt aus den Büchern über die Geschichte so selten der Schrei derer, die darin zugrunde gehn?
-
Was Schopenhauer von der Philosophie sagt – «Eine Philosophie, in der man zwischen den Seiten nicht die Tränen, das Heulen und Zähneklappern und das furchtbare Getöse des gegenseitigen allgemeinen Mordens hört, ist keine Philosophie» –, gilt es nicht hundertmal mehr von der Geschichtsschreibung? Es ist die Geschichtsschreibung, die die großen Verbrechen salonfähig macht. Und die großen Verbrecher berühmt.
-
Die sogenannte Ehre: Das meiste, was dafür geschah und geschieht, gehört zum Unehrenhaftesten auf Erden.
-
Wer wirklich lebt, lebt stets zur rechten Zeit. Doch gibt es Zeiten, die es fast unmöglich machen, wirklich zu leben.
-
Meine Skepsis bewahrt mich davor, Fanatiker zu werden – wovor noch kein Glaube geschützt hat.
-
Ich kann die ‹großen Wahrheiten› nicht sehen, schon wegen des Blutes daran.
-
Der Tag, an dem ein Mensch einsieht, nie und nimmer alles zu wissen, ist ein Trauertag, notiert Julian Green. Ich dagegen finde selbst das wenige, das ich weiß, eigentlich schon zu viel, um damit leben zu können.
-
Ich bin ungebildet – das Ergebnis lebenslanger Studien.
-
Wenig lernte ich im Lauf des Lebens so begreifen wie die Unbegreiflichkeit des Ganzen.
-
«Die Realität ist eine Illusion», sagt Einstein. Und die Illusion? Eine Realität.
-
Jede Ungewißheit, auf die ich stoße, flößt mir mehr Vertrauen ein als alle Gewißheit ringsum.
-
Die Geheimnisse der Welt ertrage ich gut; nicht die Erklärungen dafür.
-
Das Leben wird immer schöner, sagte Stifter, je länger man lebt – und brachte sich um.
-
Alles tiefe Denken entspringt dem Zweifel und endet darin.
-
Lieber möchte ich in tausend Zweifeln sterben als um den Preis der Lüge in der Euphorie. Warum also nicht alles metaphysische Gemunkel preisgeben, jeden religiösen (und nicht religiösen) Absolutheitsanspruch, jede religiöse (und nichtreligiöse) Intoleranz? Warum nicht friedlich und freundlich werden, zum Wissen erziehen, soweit man wissen kann, und zur Liebe – in einem kurzen Leben auf einer änigmatischen Welt?
-
Das Hauptmotiv des Unsterblichkeitsglaubens ist unser Selbsterhaltungstrieb. Einwände sind da ziemlich zwecklos.“
-
Psychologisch gesehen, war kaum Gott das erste Interesse des Menschen, sondern die eigene Fortexistenz. Als deren Garantie gleichsam mag er den Höchsten hinzuerfunden haben.
-
Alles tiefe Denken entspringt dem Zweifel und endet darin.
-
Jede Ungewißheit, auf die ich stoße, flößt mir mehr Vertrauen ein als alle Gewißheit ringsum.
-
Meine Skepsis bewahrt mich davor, Fanatiker zu werden – wovor noch kein Glaube geschützt hat.
.
