.
Mir imponiert Francois Villon, weil er sich schon vor Jahrhunderten getraut sich gegen die Obrigkeit und die Pfaffen zu stellen und sich kein Blatt vor dem Mund nahm. Er war auch schonungslos gegen sich selbst und scheute kein Risiko. Mir gefällt auch seine klare und schnörkellose Sprache.
Aus Wikipedia
François Villon (* 1431 in Paris; † nach 1463; sein eigentlicher Name war vermutlich François de Montcorbier oder François des Loges) gilt als bedeutendster Dichter des französischen Spätmittelalters.
In seinen beiden parodistischen Testamenten und in zahlreichen Balladen verarbeitet er die Erlebnisse seines abenteuerlichen Lebens als Scholar, Vagant und Krimineller. Während für die Zeitgenossen vermutlich vor allem die satirischen Strophen auf zeitgenössische Pariser Honoratioren von Interesse waren, schätzt man ihn seit der Romantik wegen seiner eindringlichen Gestaltung der stets aktuellen Themen Liebe, Hoffnung, Enttäuschung, Hass und Tod, besonders im ersten Teil des Großen Testaments.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon
Sehr interessant finde ich Villons Testament.
Das Große Testament
Als mich das Blut durchkochte dreißig Jahr
und Tag und Nacht nur Gram und Schande war,
da bin ich auch kein großes Licht gewesen,
auch nie als Narr von einem König angestellt.
Mich haben harte Besen
vom Mutterleib hineingefegt in diese Welt.
Doch du, Herr Bischof, Hund, du kannst mich nit
verfluchen, weil ich bitter Strafen litt.
Ich bin noch lange nicht dein Sklave hier,
du Judas, bin auch nicht dein Schmeicheltier.
Vergessen wird dir nie die Kerkerzelle,
als draußen Sommer war mit Feuermohn und Wein
und viele Frauen bettelnd auf der Schwelle
zu meinem Herzen lagen. Ach, du Stein;
der Satan wird dir zahlen, wie du mich so hart
geschlagen hast und mich genarrt.
Auch Jesus, der so hell brennt wie ein Stern,
der schont gewiß nicht all die feinen Herrn,
die mir so manche Freude stahlen
bei Nacht und auch bei Tageslicht;
sie werden es im Feuerofen zahlen,
mit keinem Geld entgehn sie dem Gericht.
Darüber wird vielleicht noch mancher Winter schnein
und ich ein armer und gejagter Dichter sein.
Oft denk ich deiner auch, mein Kamerad;
daß vor mir du verdarbst, ach, das ist schad.
Ich träumte heut, du bist ein Stern geworden,
der erste, wenn die Sonne untergeht,
dort, wo sonst keine Sterne stehn im Norden.
Jetzt hast du Nacht für Nacht mein Stoßgebet;
und daß statt deiner ich dereinst im Kerker saß,
wie gut, daß ich es bald verschwitzte und vergaß.
Gepeinigt hast du mich gar manche Nacht,
du siehst, ich habe mich deshalb nicht umgebracht,
dein Mädchen war mir Beistand, wenn’s mich quälte,
und hat mit ihrem Fleisch mich gut genährt.
Ach, keiner in der Welt, den ich zum Bruder mir erwählte,
hat mir so reichlich Huld und Gunst gewährt.
Jetzt kommt ein guter Wind von Flandern her
und läßt mich Erde schmecken, Wald und Meer.
Auch Du, Maria, warst nicht schlecht zu mir,
mit Deinem Bild im Herzen schlief in mir das Tier.
Auch den Apostel Sankt Johannes kröne
mein Dankwort für so manchen Trost in großer Not.
Und dir, mein König, stolz im Kranz der Söhne,
erflehe ich den Sieg und Englands Tod;
es blüh dir Ruhm und Ehre für und für
und daß Sankt Petrus gnädig öffne dir die Himmelstür.
In dieser Welt, wo alles grau verweht,
dir, liebe Mutter, schnell noch ein Gebet.
Sei du der Baum, dess Blätter ewig dauern
und der uns immerblühend goldne Früchte schenkt.
Dir wird der Himmel nicht mit schwarzen Mauern
verrammelt sein, wenn der Herr Jesus deine Hände lenkt.
Du hast dich nie mit fremdem Gut gemein gemacht,
du hast gedarbt und an den Sohn gedacht.
Vielleicht erlöste dein Gebet mich aus dem Hungerloch.
Und nun nach bittrer Wochen Qual und Joch,
willst du, mein Herz, mir schnell den Abschied schreiben?
Ja, weil ich elend bin, zu nichts mehr gut,
muß ich wohl mit dem dunklen Wasser treiben
und durch mein Blut schwärt keine andre Glut:
Weil ich kein Geld mehr habe, auch kein Weib,
sing ich dies Winterlied nicht nur zum Zeitvertreib.
So lang ich Augen habe und noch einen Laut
und unter meinem Hintern noch ein Büschel Kraut,
will ich sie küssen, deine Sorgenhand,
die mich erhoben hat von Schanden allerhand.
Es kann mich nichts mehr schrecken,
ich seh nur dein Gesicht, nur deinen Mund,
ich darf in meinem Traum ihn schmecken
und schmecke mich vielleicht daran auch noch gesund.
Des ganzen Lebens schwarze Litanei,
vom Mutterleibe bis zum Todesschrei,
die langen Wanderungen durch die kalten
Gelächter aller Menschen und zuletzt
der Streich des Henkers, haben böse Falten
in mein Gesicht gemacht, mich so herumgehetzt
wie Wölfe, fort aus einem warmen Nest gejagt
und nie nach meinem Leid gefragt.
Mir hat’s die Augen müder noch gemacht,
als alle Schriften, die ich manche Nacht
gelesen habe in der Klosterzelle.
Und bin ich auch gewandert ohne Kreuz und Stab,
es sprang der Bach im Feld mit froher Welle
an mir vorüber und auch grüne Waldung gab
mir das Geleit zu allen Jahreszeiten
bis tief hinein in die wildfremden Weiten.
Nicht immer brauchen oben Sterne sein,
Gott kommt auch mit den schwarzen Wolken überein.
Er hat noch jedem seinen Sarg gegeben
und gab der Jugend einen hellen Mut.
Wie mancher führt im Mai ein Lasterleben
und der November nimmt ihn auf in eines Klosters Hut.
Dort fliegen Engel ein und aus
als wär’s ein Tauben- oder Hurenhaus.
Und wünscht auch mancher jetzt schon meinen Tod;
es kommt zuletzt ein großes Morgenrot,
dort wird gezählt und abgewogen,
und wer mich quälte, wird die Prüfung nicht bestehn.
Um ihre Freuden sind die Herren jetzt betrogen,
sie werden dunkle Straßen gehn,
dort blühen keine Blumen mehr,
dort sind nur Steine kalt und leer.
Als Alexander noch ein Kaiser war,
wie schienen da die Sterne wunderbar
auf jeden Schelm herab und gaben ihm so frohen
Gewissensmut und rechtes Wort zur Zeit.
Wollt ihn ein blasser Henkertod bedrohen,
sah ihn der Kaiser an mit Gnädigkeit
und fragte mitten in dem Schlachtgebrumm:
„Bist du ein Räuber worden, ei, warum?“
Da sprach der Mann: „Warum beschimpfst du mich?
Bin ich nur darum Dieb vor dir, weil wenig ich
gestohlen habe? War mir deine Macht gegeben,
dann könnte ich auf Erden gerade so wie du
hoch über allem Volk als Herrscher leben.“
Da schloß der Kaiser schmerzlich seine Augen zu
und sprach: „Ich pflanz dich jetzt in bessre Erde ein
und will mit Fleiß und Lust dein Gärtner sein.“
Da gingen viele Jahre hin in Gnade und mit Glück
und nie fiel dieser Mann in sein gewesnes Tun zurück,
er hat mit reiner Herzenslust
des Kaisers gute Tat vergolten.
Wie oft hab ich mich schon ein Narr gescholten,
daß ich mir solchen Kaiser nit gewußt.
Ich weiß, ich bin sehr oft ein Stümper nur,
das Elend hält mich fest an seiner Nabelschnur.
So trieb ich mich herum auf schlechtem Pfad
und Böses wuchs herauf selbst aus der guten Tat,
ich habe nichts dabei errafft und nicht gespart,
bin arm geblieben und ein Lumpenhaufen.
Nun ist mein Haupt ganz grau und ausgehaart,
und dafür kann man keine Herzenslust sich kaufen.
Mir hält die Erde hin die Knochenhand
und Würmer graben mich hinunter in den Sand.
Wie war als junger Bursche ich so stolz
auf mein Gesicht, schoß überall Kobolz,
zuletzt hinauf auf einen weißen Leib,
der nährte mich mit süßen roten Beeren
und war der schönste Zeitvertreib
den Sommer lang. Das wird nie wiederkehren.
Dahin der Nachtigall Musik, der Maientanz,
was blieb, ist dieser Dornenkranz.
Es ist kein Feld und ist kein Strohsack mein,
die Sippschaft läßt mich nicht ins Haus hinein,
weil ich so räudig bin und in zerrissnen Schuhn.
Morsch sind im Maul die Zähne mir schon sehr
und weh will jeder Schritt mir tun.
O käm noch einmal nur die gute Fee daher;
mein Herz, es ginge wieder in dem raschen Schlag
und läge da bei einem weißen Reh im Rosenhag.
Ein Mannsbild, sorgendürr und hungerkrank,
das findet nirgends einen Kuß zum Dank,
ein andrer frißt, was mir zur Lust geboren
mit rotem Mund und blauem Augenstern.
Ich habe meinen Thron im Himmelbett verloren
an einen samt- und seidnen Herrn.
Der charmusiert mit meinem Herzgemahl
und macht den Bauch ihr dick, die Wangen schmal.
Ach, hätt ich nicht den Mai so schlecht vertan,
war ich noch jetzt in manchem Korb der Hahn,
wer aber will mich armen Tor
jetzt noch ins Bett und Kinder von mir wissen?
Wer duldet diesen Kopf, den einst der Henker schor,
auf einem reinen weißen Seidenkissen.
Als ich die Schule schwänzte, da beganns
mit mir bergab zu gehn, wuchs mir der Satansschwanz.
Ich brauch mich nicht zu sorgen, daß von dem Wenigen mir
noch jemand etwas raubt. Nicht dort, nicht hier
ruht alles, was mein eigen war in Bitterjahren
und so, wie einstens den verlernen Söhnen schon,
kräht auf dem Mist ein Hahn mir nichts als Hohn,
und wenn er dreimal kräht den gleichen Ton,
dann muß ich in das Grubenloch hinunterfahren,
und oben blüht vielleicht ein Büschel Mohn.
Es ruht dort unten schon so mancher Kamerad,
der Treue mir versprach und hielt. O gute Tat!
Nur von den Frauen, keine hat es so gehalten.
Zum Abschied spein sie mir jetzt ins Gesicht
und möchten auch dazu noch fromm die Hände falten,
doch wenig wiegt vor Gott solch ein Gewicht
und wiegen sie ihm dennoch viel durch meine Schuld:
Ich habe Zeit und üb mich weiter in Geduld.
Ich war wohl nie ein zager Tränenwicht,
der, eh man schlägt, schon in die Knie bricht,
die Zeit hat mich mit einem dicken Fell belehnt,
das schwemmt von seiner Stelle fort kein Regen,
und wer in meinem Kopf nur Häcksel wähnt,
den kitzelt immer noch mein guter Degen,
er fragt nach keiner Quint und keiner Terz,
er nimmt sofort den Weg ins Herz.
So manche Herren sind groß geworden und so stolz,
sie geben niemand was von ihrem Brot und Holz,
in güldnen Wagen fahren sie mit weißen Pferden
und haben Mohren in der Dienerschaft sogar.
Sie haben schon ihr Himmelreich auf Erden
und werden auch nicht eingehn zu der Engelschar,
wenn mit Drommeten über Nacht die Stadt
zusammenkracht und niemand mehr hier seine Heimat hat.
Und mancher fuhr ins Kloster ein zur letzten Ruh
und gab sich aus. ging barfuß ohne Schuh.
Ich aber bin der ausgelachte Narr geblieben,
mein Leben starb wie Zunder weg und Stroh.
Vielleicht hab ich ein Lied wem aufgeschrieben,
und war’s zu Dank ihm, bin ich leise froh.
Vielleicht denkt manche Jungfrau an Villon zurück,
der ich die Unschuld ließ, ich wünsch ihr weiter Glück
Nur was ich leiden mußte, werde ich nicht los,
es will nicht mehr heruntergehn von meinem Schoß,
ich muß es wiegen wie ein Kind und muß es küssen
und zieh mir eine Schlange an dem Busen groß.
Einst wird es sich wohl doch verwandeln müssen
und mir dann in die Augen sehn: Wer bist du bloß,
daß du so lange mich geduldig trugst
und nicht mit allen vieren um dich schlugst.
Im Wald, da ruht ganz still ein tiefer See,
sind schön Gewürm darin und, wenn ich tiefer geh,
der muntren Fische grünlich goldne Farben.
Da wünsch ich mir schon lang die letzte Ruh,
da sollen sein gebettet meine Sorgen.
Ich steh schon lange mit dem Tod auf Du und Du,
ich brauch auf keinen Weiser mehr zu schaun,
ich suche mir, will’s Gott, ein Loch im Heckenzaun.
Mich freut kein Haus, mich freut schon lange nichts,
mein Herz, wie eine Dornenkrone stichts.
Ich bin nie Gottes liebster Sohn gewesen,
ich ging dahin, wie mich die Laune gerade trieb,
mich hätten gern Zigeuner aufgelesen,
doch war ein Schoß, wo ich geborgen blieb.
Jetzt hat die liebe Frau ganz weißes Haar
und ist allhier schon sechzig Sorgenjahr.
Auch Laster sind von Gott gesandt und gut;
wohl dem, der sie bis zum bittren Ende tut.
Wer sie nicht kennt, der kann auch nicht von Sünden
erlöset werden durch des Herren Blut.
Woher ich, kam, will ich auch münden.
Im Mutterschoß, da ist es, wo man schöner ruht
als in dem Freudenbett der Königin,
denn solche Nächte gehen oft wie ein Begräbnis hin.
Wer sterben muß, ach, der stirbt hin mit Weh
im Winterwald, beim Mond, im schwarzen Schnee.
Ist eine Schwester da mit Galle und mit Essigschwamm,
wird niemand dir den Platz wegnehmen,
und wo du liegst, da wird man in den Stamm
drei Kreuze schneiden und den Ort verfemen.
Zur Erde wird dein Fleischernes alsbald
und morgen schon die große Jagd darüber schallt.
An mir ist wirklich nichts verloren hier.
Doch du, du schönes weißes Schmeicheltier,
mir nachgesprungen, weil er dich verführte,
der arge Lump mit Federhut und Sarazenenschwert,
und nicht zum Eheweib vor Gott erkürte.
Du bist der Himmelfahrt schon wert
und auch des Paradieses höchsten Lohn;
vom Haupte der Marie die güldne Krön.
Dein Bild vor Augen, also schlaf ich ein.
Es wird nur eine kleine Reise sein,
dann werden mir die Augen überlaufen
vor all den Sternen, die mir Spielgefährten sind,
von Pfaffen nicht mehr billig einzukaufen
für ein Versteck im Kleiderspind.
Dann wirst du, sanftes Reh, allein nur mein
auch ohne Kranz und Schleier sein.
So hab ich nun die Augen leise umgedreht,
ein Rabe plärrt dazu das übliche Gebet,
daß ich nun rein von allen Sünden bin geworden
und also hebt ein leiser Wind mich auf;
ich fahre aus dem winterweißen Norden
und aus der Welt und ihrem Lauf
in eine immergrüne Einigkeit,
dort brauche ich kein Haus und auch kein Kleid.
Ich sage nicht, daß jedem solch ein Glücksgenuß
verliehen wird vom lieben Gott. Wie mancher muß
mit weniger Sünden sich bescheiden und mit Tran
und Weizenmehl sich das Gesicht beschmieren,
um weißer noch, als Flaum von einem Schwan,
den Ehrenstuhl im Gotteshaus zu zieren.
Dafür singt auch an seinem Sterbebett
ein Nonnen- oder Mönchsquartett.
Bei mir ist’s, wie gesagt, ein Rabenaas,
das singt nicht schön und diesmal nur zum Spaß;
denn mit dem Ende war’s noch nicht ganz richtig,
ein Landsknecht hat mich wieder aufgejagt
und nahm mein Leid so wichtig,
daß er mich in das „Warme Nest“ mitnahm,
und dort bangt keine Frau um ihre Scham.
Mit ihrem roten Mund hat sie mich auskuriert
und manches andere noch in meinen Schlund hineinfiltriert.
Wie viel ist nur für unsereinen schön und gut
und albern, wenn ein Greis sich damit wichtig tut.
Seht nur, wie er das schwarze Maul aufreißt,
wie seine kleinen Äuglein sich verdrehn,
wenn sich kein Mädchen mehr in seinen Fisch verbeißt,
und wäre sie vom Kopf bis zu den Zehn
ein abgegrastes Ackerstück …
selbst das war für den Onkel noch zuviel an Glück.
Ich meine nämlich jetzt den Herrn Ronsard,
der ehedem von meinem Kral der Gutsbesitzer war,
für jeden, der mit einem freundlichen Besuch
uns ehrte, habe ich drei Groschen bluten müssen,
dabei hat es bei ihm gerochen wie in einem Poggenluch,
und oft verging so dem Besuch das Küssen,
dabei hat meine sich besonders viel
Pläsier erdacht für ihr berühmtes Flötenspiel.
Auch bei dem Herrn Ronsard versagte es total,
als er sich heimlich in die Kammer stahl,
um ein Geweih mir aufzusetzen. (Notabene:
fünf Frauen hatte er schon in das Grab gebracht,
und immer noch lag auf der straffen Bogensehne
ein krummer Pfeil bereit.) Der alte Bock
bekam sein Fett kaum noch hinein in sein brokatnen Rock.
Ich habe einen neuen ihm nach Maß vermacht.
Doch lassen wir das Thema jetzt,
sonst fühlt noch mancher alte Sünder sich verletzt
und hetzt den Staatsanwalt mir auf den Hals;
von wegen Unzucht, Völlerei und Afterkunst.
Ich habe nämlich keinen blauen Dunst
vom Paragraphenkram und kenne bestenfalls
den Henker, dem ich einmal nur mit knapper Not
entwischt bin, denn der Galgen ist kein schöner Tod.
Ich will mich lieber seitwärts, wenn’s geht auch splitternackt
noch einmal in ein rotes Mohnfeld legen.
Es ist so schön (der Fromme denkt: wie abgeschmackt!),
wenn rudelhaft die Wolken durch den Himmel fegen.
Mir schmeckt nun einmal dieser Zug
ins Tierbereich. Was drüber ist, das ist Betrug
an jenem Mark und Drüsensaft,
der uns das himmlischste Vergnügen schafft.
Ich bin wahrhaftig nicht das Menschenkind,
das immer stöhnt, wenn mal das Glück vorüberrinnt.
Ich denk, der Herrgott hat uns allesamt aus dem Morast
herausgefischt und seinem Bilde angepaßt.
Es liegt an euch, wenn ihr schon vor der Zeit verblüht.
Ich habe noch mit mir soviel Geduld
und stecke noch so tief in meiner Schuld,
daß mir der Schädel wie im Fieber glüht.
Es tröstet, wenn zumal die jungen Dinger mich
für jenes sagenhafte Einhorn halten,
das sie auf ihrem Freudenstrich
begehren, um mit ihm sich in das weiche Gras zu falten.
Ich habe manchmal selber nicht kapiert,
wie schnell mir oft die Augen übergingen,
und dann war es auch schon passiert.
Frag mich nicht was, man spricht nicht gern von solchen Dingen.
Mein Landesherr, der denkt in diesem Punkt zur Zeit
ein wenig ungenierter und er schreibt sein Leid
und auch die Lustgefühle mit dem Federkiel
ins Tagebuch. Tät François Villon dies auch,
dann wäre es wohl aus mit seinem faulen Bauch.
Denn gerade der, der ist die Hauptperson im Spiel
und deshalb singe ich zuguterletzt noch fix
ein schlichtes Lied, das jeden freut. Und weiter nix.
Wie es um Liebe rundherum beschaffen ist
und daß der Hunger sich nicht selber frißt,
das kann nach mir jetzt jeder Esel sagen,
und sicher lohnt es sich auch dann für ihn.
Der erste muß sich mühen einen Baum zu schlagen,
der nächste wählt den besten Splitter Kein
sich aus, ernährt sein Hirn mit diesem Licht,
woher er’s nahm, ach, danach fragt die Mitwelt nicht.
Inzwischen sah ich mir das Beinhaus an,
dort, wo die Schädel reihenweise auf den Brettern
ins Leere glotzen. Keinem ist in goldnen Lettern
ein Titel beigefügt, ob Jüngling oder Mann,
in diesem Zustand sind sie alle gleich;
die einen waren Richter einst und Advokaten,
die einen Ziegelbrenner, die anderen Soldaten,
der eine hatte nichts, der andere, der war mehr als reich.
Ob Jägermeister oder Schinderknecht,
ob aus Findelhäusern oder fürstlichem Geschlecht;
die hohlen Köpfe sind nicht da zum Herzelfreuen.
Mir wird’s ein wenig windig hinter meiner Stirn,
in welchem Sinn wir Menschen uns erneuen,
wenn nichts mehr da ist von dem bißchen Hirn.
Ich bin dafür: die Finsternis bleibt Finsternis
und ob’s im Himmel lichter ist, ist ungewiß.
Und wer da glaubt, daß all die Weibsen hier
(entkleidet der Behänge und der Spangen Zier)
sich dennoch von den Männern unterscheiden:
nichts wird in diesem Punkte offenbar.
Sie haben immerhin, ich will mich nicht dran weiden,
zurückgelassen, was allein ihr Eigen war,
um uns damit zu fischen.
Der Staub liegt hier gleich hoch auf allen Tischen.
Denn so allmählich kommt der Tag heran,
wo ich vielleicht in Ruhe nicht mehr kacken kann,
geschweige Verse dichten für den Hausgebrauch.
Vor meiner Türe hockt seit vielen Jahren schon
die Kinderschar herum und wartet auf den letzten Ton
aus dem bekannten Loch. Der Teufel wartet auch
darauf und hat sogar um Vorschuß nachgesucht.
Und als ich ihm nichts gab, hat mich der Wucherer verflucht.
Aus diesem Grunde -will ich endlich reinen Tisch
mit meinem Oheim machen. Und was nicht mehr ganz frisch,
das kommt gleich auf den Mist.
Den Rest verschreibe ich zu einem Teil
der Nonne, die mit dreißig Jahren noch ganz heil
in ihrer reinen Jungfernschaft geblieben ist.
Und wieder einen Teil erhält der Henker für den Strick,
mit dem er selber sich erlöst von seinem Mißgeschick.
Ich will auch dieses Mal
mit einer netten runden Zahl
die Kirche „Unserer Lieben Frau“ erfreun.
Dafür soll mir an jedem Allerseelentag
und in der Frühe, mit dem ersten Glockenschlag,
die jüngste Frau aus dem Kabuff „Zur goldnen Neun“
die gleiche Zahl von Lilien auf den Grabstein legen
und ihr Gebiß mit einem Lied von mir bewegen.
Was sonst noch übrig bleibt von meinem Hab und Gut,
das soll man einem Bettler in den Hut
hineintun. Doch wenn dieser Tropf
vielleicht gar Dankschön sagt
und nach dem „edlen Spender“ fragt …
dann hau ihm mit dem Brett eins auf den Kopf.
Der Pfaff fragt auch nicht lang: woher?
Er sieht nur nach, ob es von Gold ist und wie schwer.
Ich hätte mancherlei auf meinem Herzen noch.
Doch, wenn man so behindert ist wie hier im Loch,
dann denkt man mehr, ob man sich wirklich streckt
und nicht die Zunge bloß in einen grünen Himmel bleckt;
Auch hab ich Sorge, daß mir aus dem Hosenbein
was Nasses läuft. Das darf um keinen Preis
mein Abschied sein, sonst weiß es morgen und brühheiß
der Nekrolog und schreibts in die Geschichte ein.
Auch wegen solcher Todesart an sich,
bin ich mir noch nicht klar, ob ich
nicht bei dem fürstlichen Gericht noch protestieren soll
Es zeugt wahrhaftig nicht von viel Respekt,
wenn man Villon, den Dichter, so verdreckt
dem Herrn zurückgibt. Doch die Welt ist voll
von Unkultur. Drum will ich auch nicht mehr
den Kopf mir kratzen für dies Hammelheer.
Ich habe ihn mir ratzekahl gekratzt,
als Dichter mehr, als auf den breiten Stufen
zur irdischen Glückseligkeit der Freuden-Nacht.
Dorthin hat man mich auch nicht gleich gerufen,
denn welches Kätzchen kauft den Kater sich im Sack?
Als Dichter aber mußte ich mich selber üben,
denn was vorher hier war, auch bei den Römern drüben,
das paßte nicht für meinen Schabernack.
„Wie dem auch sei, sagt in der ‚Rose‘ ein Poet:
Ans Ziel gelangt nur, wer alleine seiner Wege geht.“
Den andren Weg, ihr wißt, ist Villon nie gegangen.
In diesem Fall hätt auch das peinliche Gericht
mich nicht als dritten Mann der Kumpanei gehangen.
Doch eingebrannt bleibt es mir stehen im Gesicht,
solang noch warm sind meine Atemzüge,
daß ich mich nicht damit begnüge,
wie all die anderen in jenem großen Haufen,
als Schaf gleich Schaf in Frieden mitzulaufen.
Und habe ich auch keine Beißer mehr
in meinem Maul, ich muß sie dennoch zeigen
jedwedem, der aus Gott weiß welchem Winkel her
mir ein Abschieds-Amen möchte geigen.
Die Tränen hat der Wind mir weggefegt,
den Dornenkranz das Schicksal mir aufs Haupt gelegt.
Er war mein Eigen, keinem fortgestohlen,
denn zweimal kann sich solch ein Mißgeschick
bei weiteren Zeitgenossen nicht mehr wiederholen,
auch nicht in eines Traumes Augenblick.
Mir träumte nie ein anderer als ich zu sein,
und fuhren auch die Huren so dazwischen,
als ginge ich zu weißen Fürstenkindern ein …
am Morgen war’s vorbei mit dem Im-Trüben-Fischen.
Ich sause ab, ich sage gern ade.
Bald trage ich ein Kleid, so weiß wie Schnee.
Es braucht nicht grad der Himmel sein,
wo man mir eine kleine Kammer gibt.
Ich habe einmal die Kathrein geliebt,
man weiß wie sehr. Sie mag mich wieder freien
und geht’s in ihrem Kral wie damals zu,
dann, liebe Seele, hast du endlich Ruh.
.
Gruß Hubert
.
Mein Landsmann Norbert C. Kaser war nie ein Bequemer, zu sehr juckte es ihm auch nach Provokation, um die für ihn zu engen Fesseln der Südtiroler Heimat und bornierter Künstler-„kollegen“ zu sprengen. Im folgenden einige Ausschnitte aus seinem Wirken und kurzen Leben (1947 – 1978).
.
Ein streitbarer Tiroler war Norbert C. Kaser allemal, erst nach seinem Tod gewann er einen gewissen Einfluss über die Grenzen seiner Heimat hinaus. Nun erscheint ein großer Teil seines Werkes als Taschenbuch.
Von Matthias Kußmann
.
 Bruneck, wo Kaser sein Leben lang wohnte. Das Bild ist von 1964, Kaser war damals 16 Jahre alt. (picture alliance / dpa)
Bruneck, wo Kaser sein Leben lang wohnte. Das Bild ist von 1964, Kaser war damals 16 Jahre alt. (picture alliance / dpa)
.
.
„waer ich doch ein fisch
laege vergiftet im wasser
zur trauer den weibern
waer ich ein weitentfernter
vietnams
verfault im reis
zur freude den maennern
waer ich ein totgesoffner
am innsbrucker bahnhof
alles waer ich gern
nur nicht bei euch
waer ich nur ein toter taxilenker
waer ich nur ein rentnermoerder
waer ich nur ein kinderschaender
waer ich nur student
alles
nur nicht bei euch“
.
Der Anfang eines Gedichts, das Norbert C. Kaser um 1970 schreibt. Er sympathisiert mit der 68er-Bewegung und tritt später in die Kommunistische Partei ein – allerdings in Südtirol, weitab der studentenbewegten Metropolen. Und sein Protest gegen die Väter und den Kapitalismus ist nicht, wie damals häufig, modische Pose, sondern innere Notwendigkeit. Kaser ist Zeit seines kurzen Lebens ein Außenseiter. 1947 in ärmlichen Verhältnissen unehelich geboren, von der Großmutter verteufelt, der Vater machte sich aus dem Staub.
„das gehoeft
brenn vaterhaus brenn
brenn großmutterhaus
das vieh ist heraus
sogar die henn
die verrueckten schweine
blendet das licht
gellend faellt der hof
in sich
brenn zu asche
nordwind
vertreibs
brenn vaterhaus brenn
brenn großmutterhaus
das vieh ist heraus
& auch die henn“
Kaser fällt gleich zweimal durch die Matura-Prüfung. Den dritten Anlauf macht er in einem Kapuziner-Kloster, wo er versucht, Brecht als Lektüre durchzusetzen, und erstmals eigene Texte liest. Wie die Brüder reagierten, ist nicht bekannt, jedenfalls verlässt er den Orden nach einem halben Jahr – mit der Matura. Dennoch ist Kaser, auch das ungewöhnlich bei 68ern, ein gläubiger Christ – allerdings ein kritischer. 1976 tritt er aus der Kirche aus.
„da ich ein religiöser mensch bin, trete ich aus der katholischen kirche aus. (…) versuchen Sie nicht mir nachzulaufen oder mich zu belaestigen wie das verirrte schaf – lassen Sie meinetwegen Ihre ewig opfernde lammfromme herde ja auch nur keinen augenblick lang unbehuetet. – mit keinerlei hochachtung …“
Kaser studiert Kunstgeschichte, bricht es ab und arbeitet als Hilfslehrer in kleinen südtiroler Bergschulen, wo er selbst Texte für die Schüler schreibt, weil er Lehrbüchern misstraut. Er ist Mitte 20 und Alkoholiker, die Weinflasche steht beim Unterricht auf dem Pult. Da hat er bereits erste eigene Gedichte publiziert – in kleinen handgemachten Bändchen, eines heißt „Probegesaenge“, eines „20 Collagen und 20 Fuerze“. In die literarischen Karten schauen lässt er sich weder damals noch später. Durch Zufall ist ein kurzes Radiogespräch mit ihm erhalten geblieben. Kaser ist 30 und als Autor völlig unbekannt, noch ist kein Buch von ihm in einem Verlag erschienen.
„Ich bin grundsätzlich gegen Werkstattgespräche. Warum ich irgendwie was schreibe und dass ich etwas schreibe, das soll man bitte mir selber überlassen. Ich möchte auch keine Erklärungen abgeben über dieses oder jenes. Wer´s versteht – ist gut und recht. Wer´s nicht versteht – tut mir Leid.“
Seine südtiroler Autorenkollegen und ihre süßliche Heimatdichtung verspottet er – Kaser orientiert sich an der Weltliteratur. Er liest und liest, vor allem amerikanische Beatpoeten, dann Charles Olson und Robert Creeley. Wie sie nutzt er eine einfache Sprache, Alltagsjargon, Kraftausdrücke, rhythmische Wiederholungen und ungewöhnliche Metaphern. Er verdichtet seine Texte immer mehr, manchmal nähern sie sich dem Haiku, freilich einem bitteren. Wie hier, wenn im letzten Vers die anfängliche Idylle in existentielle Gefährdung umkippt:
„ueber dem meer
in fuelle der mond
die luft ein
schnitt am hals“
Dieses Gedicht steht in Kasers Handschrift auf der Umschlag-Rückseite des Bandes „herrenlos brennt die sonne“, mit dem der Haymon Verlag an den Autor erinnert. Kasers Handschrift ist klar, fast kindlich einfach.
„des esels tod
mein esel mein esel
warum bist du so tot
zucker bring ich dir
in diesem seltnen fall
& tausend kuesse von mir
im frischgestreuten stall“
Und die südtiroler Bauernkinder lernen ohne gereckten Zeigefinger, dass sich Nachdenken lohnt, dass man keine Angst vor sogenannten Autoritäten haben muss und dass sich Tiere freuen, wenn sie einen sauberen Stall haben.
„die ersten kuehe waelzen sich vor freude und bruellen, die schweine laufen quietschend davon. Um halbzehn glaenzt der ganze stall.“
Immer wieder versucht sich Kaser in kurzen Prosastücken über sein eigenes Leben und Schreiben klar zu werden. Auch dafür gibt es ein beeindruckendes Beispiel im vorliegenden Auswahl-Band. „warum gerade brixen?“ heißt der Text, in dem der Autor in gespielt naivem Ton über seinen Geburtsort nachdenkt, der ihm niemals Heimat war, über seine uneheliche Geburt und die Jahre bei den „grauen Schwestern“ in einem Nonnenkloster, wohin ihn seine Mutter als Kind gegeben hatte.
„die zeiten waren nicht die besten, aber alois, zu olang ein metzger ohne rechtschreibkenntnisse geworden, versorgte in allem frieden unsere familie mit fleisch & nahrungsmitteln, die zum großteil die grauen schwestern selber fraßen. Diese nonnen ließen mich tagelang in nassen windeln liegen, bis mein kleiner hintern fleischig war & man mich nach kastelruth in pflege gab. Dort traf mich die englische krankheit, dass mein ueberschwerer kopf nur so baumelte …“
Am Ende des Textes steht eine lakonische und Kaser-typische Volte – plötzlich wendet sich, ob ironisch oder nicht, mag der Leser entscheiden, alles zum Guten.
„meine tanten liebten mich & meine großmutter hatte spaeter keinen lieberen enkel als mich. Das ist vorlaeufig alles.“
Kaser soll häufig Briefe und Postkarten an sich selbst geschickt haben, auf denen manchmal nur ein einziges Wort stand. Einmal war es eine Karte mit Giottos Bild „Auferstehung des Lazarus“. Auf die Rückseite notierte er nur das Wort: „hoffentlich“. — Mit 28 muss er, schwer leberkrank, zum Alkoholentzug in die Psychiatrie.
„es ist ein gutes spital mit vielen freiheiten – so viele freiheiten, dass man die vergitterten fenster erst richtig spuert.“
Nach dem Entzug beginnt er wieder zu trinken. Am 21. August 1978, mit 31 Jahren, stirbt Norbert C. Kaser an einem Lungenödem als Folge von Leberzirrhose, mit grotesk aufgequollenem Leib. Sein letztes Gedicht lautet:
.
„ich krieg ein kind
ein kind krieg ich
mit rebenrotem kopf
mit biergelben fueßen
mit traminer goldnen haendchen
& glaesernem leib
wie klarer schnaps
zu allem lust
und auch zu nichts
ein kind krieg ich
es schreiet nie
lallet sanft
ewig sind
die windeln von dem kind
feucht & nass
ich bin ein faß“
Ein Jahr nach Kasers Tod erscheint die erste Auswahl seiner Werke. Mehrere Verlage erinnern im Lauf der Jahrzehnte an ihn, darunter Diogenes, die Friedenauer Presse, dann Haymon mit einer dreibändigen Werkausgabe. Er wird jedes Mal von den Feuilletons wiederentdeckt und bald darauf vergessen. Höchste Zeit also, Kasers widerborstige, zugleich poetische Texte neu zu lesen und im Gedächtnis zu behalten.
„kakteen
(…)
bluehen ist ihre staerke nicht
werft sie vom fenster
und mich dazu
mein fallen mit toenernen toepfen
ist mir musik“
.
.
Gruß Hubert
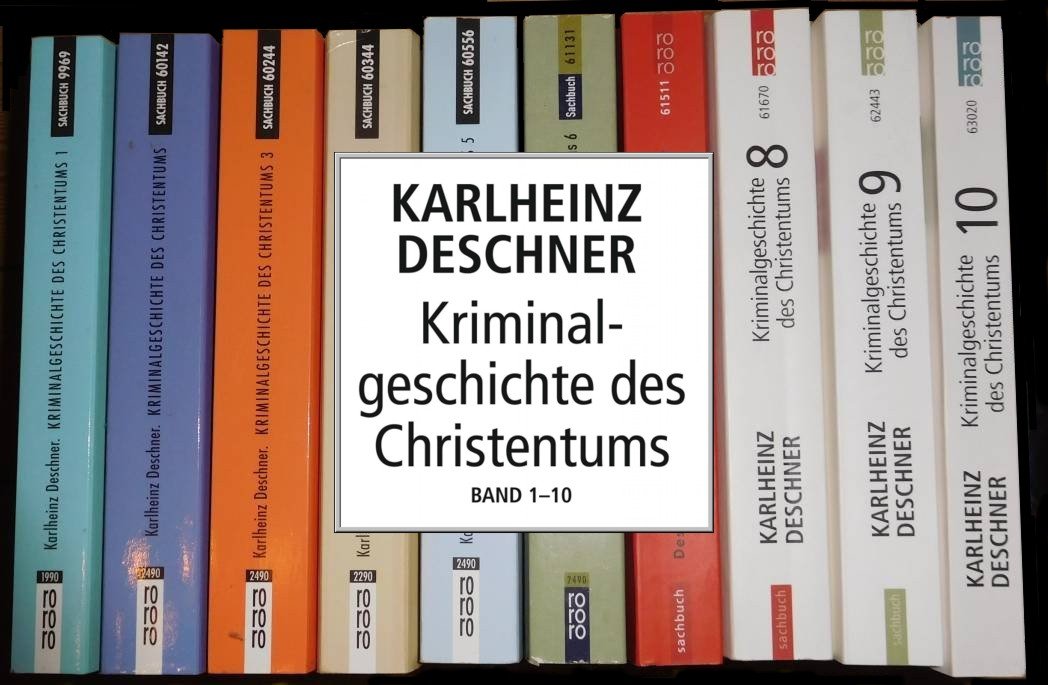




 Bruneck, wo Kaser sein Leben lang wohnte. Das Bild ist von 1964, Kaser war damals 16 Jahre alt. (picture alliance / dpa)
Bruneck, wo Kaser sein Leben lang wohnte. Das Bild ist von 1964, Kaser war damals 16 Jahre alt. (picture alliance / dpa)